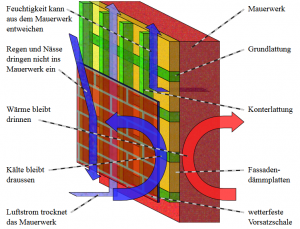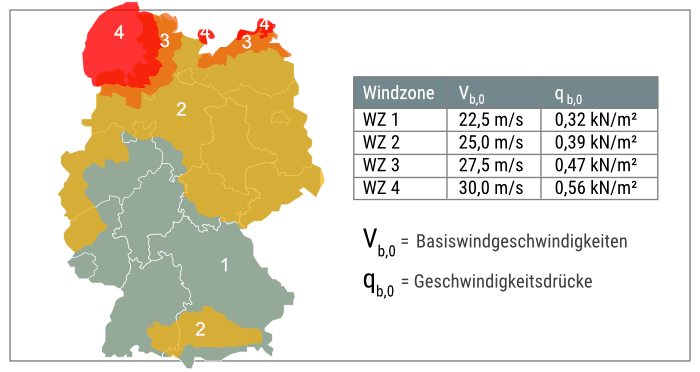Was sind Pyrite?
Pyrite, besser bekannt als Schwefelkies, bestehen aus Eisen und Schwefel (FeS₂) und kommen in vielen natürlichen Gesteinen vor. Diese Mineralien finden sich auch in den Quarzsanden, die zur Herstellung von Mineralit verwendet werden. Sobald Pyrite mit Luft und Feuchtigkeit in Kontakt kommen, beginnen sie zu korrodieren. Dabei entstehen Rost (Eisenoxid) und Schwefeldioxid, was sich durch kleine Verfärbungen auf der Oberfläche der Platten bemerkbar macht.
Pyrite und Mineralit: Wie hängen sie zusammen?
Mineralit ist ein High-Tech-Verbundwerkstoff, der aus 94 % hochfesten Quarzsanden besteht. Diese mineralischen Zuschlagsstoffe werden mit Methamethylacrylat (MMA) als Bindemittel kombiniert, um langlebige und robuste Balkonplatten herzustellen. Da Pyrite natürliche Bestandteile der Quarzsande sind, können sie in seltenen Fällen in minimalen Mengen auftreten. Trotz modernster Aufbereitungsmethoden lassen sich diese Partikel nicht vollständig aus dem Material entfernen.
Warum entsteht Pyritkorrosion?
Pyritpartikel reagieren, wenn sie mit Luftsauerstoff und Wasser in Kontakt kommen. Durch diese chemische Reaktion entstehen Eisenoxid (Rost) und Schwefeldioxid. Dieser Prozess führt zu punktuellen Verfärbungen auf der Oberfläche der Balkonplatten. Wichtig ist, dass diese optischen Veränderungen keinen Einfluss auf die Festigkeit, Haltbarkeit oder Sicherheit der Platten haben.
Beeinträchtigen Pyrite die Qualität meiner Balkonplatten?
Ganz klar: Nein!
- Festigkeit und Haltbarkeit: Pyritkorrosion bleibt oberflächlich und beeinflusst die mechanischen Eigenschaften der Balkonplatten nicht.
- Begrenzte Größe: Da die mineralische Mischung maximal 8 mm große Bestandteile enthält, bleibt die Korrosion immer auf kleine Stellen begrenzt.
- Unbedenklich für Umwelt und Gesundheit: Die chemischen Reaktionen setzen weder giftige Stoffe frei noch gefährden sie die Gesundheit der Nutzer.
Was tun bei Pyritverfärbungen?
Die Verfärbungen durch Pyrit lassen sich in der Regel einfach entfernen, wenn sie frühzeitig behandelt werden. Um die optische Qualität Ihrer Balkonplatten langfristig zu erhalten, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
- Früh handeln: Entfernen Sie erste Verfärbungen mit einfachen Reinigungsmitteln, um eine Ausbreitung zu verhindern.
- Regelmäßig kontrollieren: Eine regelmäßige Überprüfung hilft, größere Verfärbungen zu vermeiden.
- Langfristig pflegen: Sollten die Verfärbungen unbehandelt bleiben, könnten sie sich ausweiten. In diesem Fall ist eine intensivere Reinigung notwendig, um die Oberfläche wiederherzustellen.
- Pyrit Nasen entfernen: Sollten Ausblühungen nicht frühzeitig behandelt werden müssen diese mit Entfernungsmittel beseitigt werden. Hierzu stellen wir eine Anleitung bereit und unterstützen Sie gerne bei Fragen. Unsere Verarbeitungsanleitung finden Sie im Downloadbereich.

Mit einer schnellen Reaktion sparen Sie Zeit und Aufwand. Ihre Platten sehen länger aus wie neu und bleiben optisch ansprechend.
Warum können Pyrite nicht vollständig ausgeschlossen werden?
Pyritpartikel sind unmagnetisch und lassen sich auch mit den fortschrittlichsten Aufbereitungsmethoden nicht vollständig aus den Quarzsanden entfernen. Da Mineralit hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen besteht, können wir die absolute Pyritfreiheit nicht garantieren. Dies beeinflusst jedoch in keiner Weise die Qualität oder die Funktionalität der Balkonplatten.
Zusammenfassung: Pyrite und Mineralit-Balkonplatten
- Optische Veränderungen möglich: Pyrite können punktuell zu Verfärbungen führen, die sich leicht entfernen lassen.
- Keine Beeinträchtigung der Qualität: Die Festigkeit und Haltbarkeit der Balkonplatten bleiben vollständig erhalten.
- Einfache Pflege: Mit rechtzeitiger Behandlung vermeiden Sie größere optische Veränderungen.
Mit Mineralit-Balkonplatten entscheiden Sie sich für langlebige und robuste Produkte, die auch nach Jahren der Nutzung zuverlässig und sicher bleiben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Sind Verfärbungen durch Pyrite gefährlich?
Nein, die Korrosion von Pyrit setzt weder giftige Stoffe frei noch stellt sie ein Risiko für Umwelt oder Gesundheit dar.
2. Muss ich eine Balkonplatte mit Pyritverfärbung austauschen?
Nein, die Verfärbung ist rein optisch. Die Platte bleibt weiterhin belastbar und stabil.
3. Wie kann ich Pyritverfärbungen verhindern?
Regelmäßige Kontrolle und eine sofortige Reinigung erster Verfärbungen helfen, die optische Qualität Ihrer Platten zu erhalten.